Exkursionen
Die Exkursionen führen in der Regel über normale Wege und Pfade, teilweise werden aber auch längere Strecken im Gelände zurückgelegt. Besondere Schwierigkeiten sind mit wenigen Ausnahmen nicht gegeben. Trotzdem wird eine gute Exkursionsausrüstung (festes Schuhwerk, Sonnen- und Regenschutz, Eigenverpflegung) empfohlen.
Die detaillierten Anforderungsprofile und Wegbeschreibungen finden Sie nachfolgend bei den jeweiligen Beschreibungen der Exkursionen.
Exkursion 1: Hagen – Weißenstein – Hasselbachtal/Schälk – Steltenberg
Themen: Orchideenreiche Buchenwälder auf Kalk, Waldentwicklung nach Trockenschäden im Buchenwald, Waldinnen- und -außensäume, Pflege von orchideenreichen Brachen und Wiesen, Probleme der Waldentwicklung nach Eschensterben, Vegetationsentwicklung in einem renaturierten Kalksteinbruch, Naturschutz im Ballungsraum
1. Ziel: NSG „Weißenstein/Mastberg“
Das NSG „Weißenstein“ ist das älteste Naturschutzgebiet Hagens aus den 1930er Jahren. 1994 wurde auch der benachbarte Mastberg unter Naturschutz gestellt. Beide Gebiete bestehen aus teilweise dolomitisiertem Massenkalk, der im Bereich des Mastberges auch heute noch abgebaut wird. Der Weißenstein fällt nach Osten zum Tal der Lenne in fast 50 m hohen Klippen ab. Die Waldflächen von Mastberg und Weißenstein sind teilweise steil west- und vor allem südexponiert. Der Boden ist überwiegend sehr flachgründig, so dass die Buche in den Trockenjahren seit 2018 deutliche Trockenschäden erlitten hat und in Teilen abgestorben ist. Im Unterwuchs und in der Strauchschicht hat sie sich allerdings gut durch Naturverjüngung regeneriert. Dieses Regenerationsstadium ist im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Buchenwälder im Klimawandel zumindest für den hiesigen Raum interessant.
Der erste Stopp befindet sich in einem solchen, teilweise aufgelichteten Buchenwald. Es handelt sich um einen orchideenreichen Seggen-Buchenwald (Carici-Fagetum) mit Übergangsstadien zu anderen Buchenwaldgesellschaften. Typische Arten sind: Anemone ranunculoides, Campanula trachelium, Carex digitata, Carex montana, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Daphne mezereum, Epipactis microphylla, Helleborus viridis, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Neottia nidus-avis, Orchis mascula, Phyteuma spicatum, Primula veris, Ranunculus auricomus agg., Vincetoxicum hirundinaria und Viola reichenbachiana.
Der zweite Stopp erfolgt an einem sonnenxponierten Waldaußenrand des Weißenstein. Hier sind besonders Astragalus glycyphyllos, Betonica officinalis, Carex polyphylla, Clinopodium vulgare, Ophrys apifera und Origanum vulgare auffällig.
Am dritten Stopp wird ein Waldinnenrand an einem breiten Forstweg gezeigt. Neben den oben genannten Arten ist hier vor allem ein großer Bestand von Lithospermum officinale bemerkenswert.

Buchenwald im NSG „Weißenstein“ (Fotos: C. Gerbersmann).

Lithospermum officinale, Ophrys apifera, Cephalanthera longifolia, Epipactis microphylla, Phyteuma spicatum (Fotos: C. Gerbersmann, G. Blaich).
2. Ziel: Hasselbachtal/Schälk
Das Gebiet des NSG „Henkhauser- und Hasselbachtal“ setzt sich aus tief eingeschnittenen Bachtälern mit umgebenden Wäldern zusammen. Darin eingebettet sind kleinflächige offene Brachen und Wiesen. Die offenen Bereiche werden unter ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Geologisch ist das Gebiet kleinflächig strukturiert mit silikatischen und basischen Gesteinen im Untergrund. Entsprechend vielfältig ist die Vegetation.
Zu Beginn des Weges halten wir an einer Wiesenbrache am Waldrand mit einem Massenbestand von mehreren tausend Pflanzen von Betonica officinalis. Weitere bemerkenswerte Arten sind Dactylorhiza majalis und Selinum carvifolia.
Der zweite Stopp zeigt eine magere Orchideenwiese mit mehreren tausend Exemplaren von Dactylorhiza fuchsii. Bemerkenswerte weitere Arten sind z. B. Listera ovata, Ophioglossum vulgatum und Succisa pratensis.
Im Zentrum des Gebietes liegen die tief eingeschnittenen Bachtäler, an deren Sohle früher gut ausgeprägte Winkelseggen-Eschenwälder (Carici remotae-Fraxinetum) lagen. Durch das Eschensterben sind diese Wälder inzwischen leider stark beeinträchtigt und verändert. Die Auflichtung hat zur Ausbreitung von Rubus-Arten und Urtica dioica geführt. An diesem Exkursionspunkt geht es daher vor allem auch um die Frage des naturschutzgerechten Umbaus dieser Wälder. Typische Arten sind u. a. Caltha palustris, Carex remota, Colchicum autumnale, Crepis paludosa, Equisetum telmateia und Primula elatior.

Orchideenwiese (Foto: C. Gerbersmann).

Selinum carvifolia, Betonica officinalis, Succisa pratensis, Dactylorhiza fuchsii, Ophioglossum vulgatum, Dactylorhiza majalis, Equisetum telmateia (Fotos: C. Gerbersmann, G. Blaich).
3. Ziel: Renaturierter Kalksteinbruch im NSG „Steltenberg“
Der renaturierte ehemalige Kalksteinbruch liegt südexponiert im mittel- bis oberdevonischen Kalkstein des Mühlenberges. Die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte hat Auswirkungen auf die besondere Vegetationsentwicklung im Gebiet. Bereits 1926 wurde von der tiefer liegenden Mühlenbergstraße ein nahezu waagerechter Stollen in den Berg getrieben. Dieser wurde mit einem vertikalen Schacht zur Oberfläche verbunden. Um den Schacht herum begann der Abbau im sog. Rollochverfahren. Die mit Pressluft- und Sprengtechnik gebrochenen Steine wurden durch den Schacht in den Stollen gerollt. Dadurch weitete sich der Schacht zunächst kegelförmig, später auch in gesamter Breite auf. Es entstand schließlich ein Steinbruchkrater ohne jede oberirdische Zufahrt mit einem Durchmesser von gut 300 m. Nach Ende des Abbaus wurde der Steinbruch als Absetzbecken für die Spülschlämme der Steinwäsche des benachbarten Steinbruches verwendet. Es entstand ein Steinbruchsee, der zunehmend verschlammte. Der Betrieb wurde 1999 eingestellt und danach verfestigten sich die Schlämme, bis eine feste Oberfläche entstand, auf der sich Vegetation in unterschiedlichen Pionierstadien angesiedelt hat. Ein Teil des Gebietes ist heute mit Pionierwald bestanden, der Rest wird durch Naturschutzpflege offen gehalten.

Renaturierter ehemaliger Kalksteinbruch (Foto: C. Gerbersmann).
Der umgebende Kalk-Buchenwald enthält typische Arten wie Arabis hirsuta, Campanula persicifolia, Epipactis microphylla, Galium odoratum, Melica uniflora, Neottia nidus-avis, Primula veris und Sanicula europaea.
An den wärmebegünstigten Hängen finden sich u. a. Sesleria caerulea, Carex digitata, Acinos arvensis, Aquilegia vulgaris, Genista tinctoria, Polygala vulgaris, Securigera varia, Vincetoxicum hirundinaria.
Auf der Steinbruchsohle finden sich verschiedene Pionierstadien. Floristisch besonders interessant sind die großen Hybridpopulationen der Orchideen mit mehr als 3.000 blühenden Pflanzen, die in drei Hybridschwärmen mit sehr unterschiedlichen Blühzeiten auftreten. Die Elternarten sind Dactylorhiza fuchsii, D. incarnata und D. majalis. Vor einigen Jahren kam ein aktuell sehr großer Bestand an Epipactis palustris hinzu.
Außerdem wurden zahlreiche bemerkenswerte Schachtelhalmsippen festgestellt, die in NRW z. T. sehr selten sind oder sogar hier ihren einzigen Fundpunkt haben: z. B. Equisetum hyemale, E. ×meridionale, E. ×moorei nothosubsp. moorei, E. ×moorei nothosubsp. nipponicum, E. telmateia, E. variegatum.
Daneben finden sich weitere bemerkenswerte Arten wie Carlina vulgaris, Dianthus armeria, Euphrasia cf. nemorosa, Misopates orontium, Polygala vulgaris und Pyrola rotundifolia.

Epipactis palustris, Equisetum ×moorei nothosubsp. nipponicum, E. variegatum, Polygala vulgaris (Fotos: C. Gerbersmann, G. Blaich, M Lubienski).

Dactylorhiza incarnata-Hybride, Misopates orontium, Pyrola rotundifolia, Dactylorhiza fuchsii-Hybride, Aquilegia vulgaris (Fotos: C. Gerbersmann, G. Blaich).
Wegstrecke:
1. Ziel Weißenstein: ca. 2,5 km auf normalen Wegen und Pfaden, teilweise Steigungen mit einem Höhenunterschied von 100 m.
2. Ziel Hasselbachtal/Schälk: ca. 3 km auf normalen Wegen und Pfaden, teilweise deutliche Steigungen mit einem Höhenunterschied von 150 m.
Mittagspause mit Selbstversorgung
3. Ziel Steltenberg: ca. 500 m auf schmalen und teils steilen Pfaden, zum Steinbruch muss eine steile, etwa 8 m hohe Böschung überwunden werden (Seilsicherung, aber kein Klettern).
Exkursionsleitung: Christoph Gerbersmann, Franco Cassese
Exkursion 2: Kulturlandschaft im Kreis Olpe – Bodensaure Wiesen und Kalkmagerrasen mit Relikten historischer Flora und Vegetation, ökologisch bewirtschaftete Weihnachtsbaumkultur
Themen: Borstgrasrasen, Halbtrockenrasen, Wiesen, Wiesenmahd, Wald, Bruchwald, Arealgrenzen, Weihnachtsbaumkultur, Ackerbegleitflora, ökologisches Management
1. Ziel: Historische Wiese der Wassergewinnung Oberveischede und Bruchwald Marksiepen: Flora der Wiesen und Wälder im bodensauren Sauerland
Der Kreis Olpe liegt im Südosten des Landes Nordrhein-Westfalen. Etwa 55 % der Fläche sind bewaldet, ein Großteil des Offenlandes dient der Milchwirtschaft. Die Intensität der Bewirtschaftung durch die Vollerwerbsbetriebe nimmt nach wie vor zu. Den Schwerpunkt der Exkursion bildet eine Wiese auf saurem Untergrund. Sie befindet sich im Besitz des Wasserbeschaffungsverbandes Oberveischede, eines lokalen und privaten Wasserversorgers. Sie wurde 1966 von dem Verband gekauft und wird seitdem nachweislich nicht mehr gedüngt, aber jährlich zweimal gegen Ende Juni und Mitte September gemäht. Aufgrund ihrer Geschichte hat die Wiese einen nahezu musealen Charakter. Die flächig ausgebildetem Borstgrasrasen geben einen Eindruck, wie Wiesen vor der starken Intensivierung der Landwirtschaft in diesem Raum ausgesehen haben dürften. Neben Arten, die heute in der industrialisierten Landwirtschaft zu den Seltenheiten der Wiesenflora gehören, wie Alchemilla spp., Bistorta officinalis, Briza media, Dactylorhiza maculata, D. majalis, Danthonia decumbens, Euphrasia stricta agg., Hieracium umbellatum, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Nardus stricta, Platanthera chlorantha, Polygala vulgaris, Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus und Succisa pratensis treten Arten auf, die heute eher in Säumen, an Waldwegen oder in Wäldern anzutreffen sind. wie Anemone nemorosa, Euphrasia nemorosa, Galium saxatile, Carex demissa, C. pallescens, C. pilulifera, Lathyrus linifolius, Potentilla erecta und Phyteuma spicatum. Bis vor zwei Jahren wuchs hier außerdem eines der letzten Vorkommen von Arnica montana im Kreis Olpe. Auf dem Weg zu dieser Wiese werden wir einen Blick in eine extensiv genutzte Feucht- und Nasswiese mit z. B. Colchicum autumnale, Rhinanthus minor und Juncus filiformis werfen.

Blütenreiche Magerwiese (Foto: C. Buch).

Platanthera chlorantha, Polygala vulgaris, Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus, Danthonia decumbens, Alchemilla monticola (Fotos: A. Jagel, C. Buch).
Anschließend suchen wir den farnreichen Bruchwald „Marksiepen“ auf, der benachbart zum NSG „Buchen- und Bruchwälder bei Einsiedelei und Apollmicke“ liegt und charakteristische Arten der Bruchwälder aufweist, wie Betula pubescens, Carex echinata, C. nigra, C. rostrata, Crepis paludosa, Equisetum sylvaticum, Polygonatum verticillatum, Sphagnum spp., Valeriana dioica und Viola palustris. Dabei gehören Lycopodium annotinum und Potamogeton polygonifolius zu den Seltenheiten der Region. Der Weg zu Bruch führt über einen Waldweg, der die Gelegenheit gibt, typische Arten der Waldsäume und Waldwegränder des Sauerlandes auf saurem Untergrund vorzustellen, die in Nordrhein-Westfalen einen Schwerpunkt im Mittelgebirge haben und im Süderbergland an die Nordwestgrenze ihres geschlossenen Areals gelangen wie Blechnum spicant, Chaerophyllum hirsutum, Circaea intermedia, Hypericum maculatum s. str., Hypericum pulchrum, Luzula luzuloides, Phegopteris connectilis, Potentilla sterilis, Senecio ovatus, Solidago virgaurea und Thelypteris limbosperma.

Farnreicher Bruchwald (Foto: A. Jagel).

Potamogeton polygonifolius, Lycopodium annotinum, Thelypteris limbosperma, Carex echinata, Valeriana dioica (Fotos: C. Buch, A. Jagel).
2. Ziel: Naturschutzgebiet Dünscheder Heide: Flora der Kalkmagerrasen im Attendorner Raum
Das Attendorn-Elsper Kalkgebiet inmitten des sonst weitgehend bodensauren westlichen Sauerlandes bietet zahlreichen kalkliebenden Arten ein Vorkommen an der Nordwestgrenze ihres Areals. In diesem Kalkgebiet befindet sich die Dünscheder Heide. Es handelt sich um ein nur 1,35 ha großes Naturschutzgebiet am Rand von konventionell bewirtschafteten Äckern und wurde erst 2006 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Seine Kalkmagerrasen gehören aber schon sehr viel länger zu den artenreichsten und wertvollsten der Region. Als charakteristische Arten werden wir Anthyllis vulneraria, Aquilegia vulgaris, Bromus erectus, Carex caryophyllea, Cirsium acaulon, Danthonia decumbens, Euphrasia officinalis, Genista tinctoria, Helianthemum nummularium subsp. obscurum, Helictotrichon pubescens, Koeleria pyramidata, Linum catharticum, Ononis repens, Polygala vulgaris, Primula veris, Rhinanthus minor und Scabiosa columbaria antreffen. Besonders bemerkenswert sind große Vorkommen von Colchicum autumale und den Orchideen-Arten Orchis mascula, Gymnadenia conopsea und Listera ovata. Außerdem treten im Rasen Gentianella germanica und eines der letzten Vorkommen im Kreis Olpe der landesweit stark zurückgehenden Parnassia palustris auf. Beide werden aber zur Zeit der Exkursion noch nicht blühen. Die Offenlandflächen des NSGs werden zum Monatswechsel September/Oktober vom NABU Olpe gemäht und abgeräumt. Die Magerrasen sind flankiert vom Eichen-Hainbuchenwald trockenwarmer Ausprägung mit kalktypischen Arten wie Actaea spicata, Carex digitata, Corydalis solida, Daphne mezereum, Lathyrus vernus, Paris quadrifolia und Sanicula europaea.

Kalkmagerrasen Dünscheder Heide (Foto: A. Jagel).

Rhinanthus minor, Euphrasia officinalis, Orchis mascula, Gymnadenia conopsea, Colchicum autumnale, Briza media mit Knautia arvensis (Fotos: A. Jagel).
3. Ziel: Ökologisch bewirtschaftete Weihnachtsbaumkultur in Finnentrop
Nur etwa 12 % der Landwirtschaftsfläche im Kreis Olpe dient als Ackerland, oftmals wird Mais angebaut. Als Folge sind Ackerwildkräuter ausgesprochen selten geworden. Sowohl ökologisch bewirtschaftete als auch konventionelle Weihnachtsbaumkulturen gehören heute zu ihren letzten Ersatzstandorten. Weihnachtsbaumkulturen sind im Sauerland weit verbreitet, besonders stark auch in Teilen des Kreises Olpe. Meist handelt es sich um Kulturen von Nordmann-Tannen (Abies nordmanniana), die im Alter von etwa 10 Jahren geerntet werden. Der Unterwuchs der Kulturen wird beweidet, gespritzt oder gemulcht. Bisher sind Weihnachtsbaumkulturen floristisch und vegetationskundlich kaum untersucht. Wir besuchen eine ungespritzte und gemulchte Kultur in Finnentrop, aber auch eine direkt angrenzende, konventionell bewirtschaftete. In den ein- bis dreijährigen Kulturen ist die Anzahl der Ackerwildkräuter besonders hoch. In den letzten Jahren traten hier an Seltenheiten der Region z. B. Anagallis minima, Anchusa arvensis, Misopates orontium, Scleranthus annuus und Sherardia arvensis auf.

Ökologisch bewirtschaftete Weihnachtsbaumkultur (Foto: A. Jagel).

Anagallis minima, Myosotis discolor, Stachys arvensis, Viola tricolor, Misopates orontium (Fotos: A. Jagel).

Turritis glabra, Anchusa arvensis, Genista pilosa, Bromus commutatus (Fotos: A. Jagel).
Wegstrecke:
1. Ziel Oberveischede: Aufenthalt ca. 3 h, Wegstrecke ca. 2 km (Hinweg), wenig anspruchsvoll, etwas Steigung. Der Rückweg entspricht dem Hinweg. Für die Wiesen und den Bruch ist festes Schuhwerk angebracht.
Mittagspause: Etwa 1 h am Parkplatz. Es gibt die Möglichkeit zur Einkehr bzw. Versorgung im Café Sangermann ca. 300 m entfernt.
2. Ziel Dünschede: Fahrzeit zur Dünscheder Heide etwa 15 min. Aufenthalt 1,5 h, Wegstrecke etwa 400 m ohne Steigung.
3. Ziel Finnentrop: Fahrzeit zur Weihnachtsbaumkultur etwa 10 min. Aufenthalt 1,5 h, Wegstrecke etwa 300 m, am leicht geneigten Hang.
Exkursionsleitung: Josef Knoblauch, Dr. Armin Jagel
Exkursion 3: Industrienatur im Ruhrgebiet – Henrichshütte und Halde Rheinelbe
Themen: Ruhrgebiet, Industriekultur, Industrienatur, Hüttenwerk, Bergehalde, Ruderalvegetation, Industriewald, Sonderstandorte, Umweltbildung
1. Ziel: Henrichshütte in Hattingen: Auf den Spuren der Stahlerzeugung im Ruhrgebiet
Die Henrichshütte wurde 1854 mit dem Aufkommen der Montanindustrie im Ruhrgebiet zur Herstellung von Roheisen und Stahl gergündet. Das Hüttenwerk befindet sich in einer ehemaligen Ruhraue, die – wie viele Gebiete im Ruhrgebiet des 19. Jahrhunderts – für die Errichtung der Industrieanlage massiv überformt wurde. Nach einer bewegten Geschichte, die zwei Weltkriege und mehrere Eigentümerwechsel beinhaltet, wurde die Anlage schließlich im Jahr 1987 stillgelegt. Seit 1989 wird die Anlage durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) als Museum betrieben. Zudem gehört sie heute sowohl als Ankerpunkt zur Route Industriekultur, als auch zur Route Industrienatur des Regionalverband Ruhr. Zahlreiche Veranstaltungen wie Führungen, Ausstellungen, Workshops, das Hüttenkino oder die ruhrgebietsweite „Extraschicht“ locken im Jahr rund 100.000 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände. Trotz des intensiven Tourismus steht die kulturelle Nutzung dem Natur- und Artenschutz auf der Fläche nicht entgegen. Durch die hohe Dynamik und den großen Anteil an schnelllebigen, wenig empfindlichen Arten, ist Industrienatur vielfach sogar auf Störungen und die Schaffung von konkurrenzarmen Standorten durch den Menschen angewiesen.

Tourismusschild „Ruhrgebiet“ auf der Henrichshütte (Foto: C. Buch).
Floristisch und vegetationskundlich von Interesse sind Pionier-Bestände auf teils basenreichem Gleisschotter mit Bromus tectorum, welche reich an wärmeliebenden Neophyten sind wie Catapodium rigidum, Euphorbia maculata und E. prostrata, Eragrostis minor und E. multicaulis oder Veronica peregrina. Auf ehemaligen Bahngleisen haben sich Hochstaudenfluren aus Epilobium angustifolium, Oenothera spp., Verbascum spp., Echium vulgare und Senecio inaequidens etabliert. Diese gehen lokal in artenreiche ruderale Wiesen über, die durch Arrhenatherum elatius oder Calamagrostis epigejos geprägt sind. Schlackeaufschüttungen bilden künstliche Felsen u. a. mit Asplenium trichomanes und in Bunkertaschen kommen Gehölze wie Fraxinus ornus und Ailanthus altissimus auf. Auf dem Gelände siedeln zudem individuenreiche Bestände von Arabidopsis arenosa, die im Ruhrgebiet als typisch für Industriebrachen mit einem hohen Anteil an Gleisschotter gilt. Faunistisch relevant sind Vorkommen der Blauflügeligen Sand- und Ödlandschrecke, einer bislang noch unbeschriebenen Weberknecht-Art aus der Gattung Leiobunum, verschiedenen Wildbienenarten sowie Rostgans, Hausrotschwanz, Hohltaube und Wanderfalke, die in den alten Industrieanlagen brüten.

Ruderalvegetation mit Bromus tectorum auf Schotter, Hochstaudenflur mit Epilobium angustifolium auf Gleisschotter und Fraxinus ornus in Bunkertaschen (Fotos: C. Buch).

Arabidopsis arenosa, Asplenium trichomanes, Catapodium rigidum und Veronica peregrina (Fotos: C. Buch).
2. Ziel: Industriewald und Halde Rheinelbe in Gelsenkirchen: Sukzessionsforschung und Umweltbildung in den „neuen Wäldern“ des Ruhrgebiets
Bei der Halde Rheinelbe handelt es sich um eine Aufschüttung überwiegend aus Bergematerial der ehemaligen Zeche Rheinelbe, die im Jahr 1928 stillgelegt wurde. Das Gebiet unterhalb der Halde ist durch „Industriewald“ geprägt, ein überwiegend spontan gewachsener Wald auf industriell geprägten Sonderstandorten, der auch weiterhin seiner natürlichen Entwicklung überlassen wird. Hier befinden sich ebenfalls kleinere Aufschüttungen aus Bergematerial, Kohleresten und Bauschutt sowie Relikte einer ehemaligen Kokerei. Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscher Park Ende der 1980er Jahre wurde die Fläche zum Naherholungsgebiet erklärt. Auf dem gesamten Gelände sind Kunstinstallationen errichtet. Heute gehört die Halde Rheinelbe wie auch die Henrichshütte zu den Routen Industriekultur und Industrienatur. Auf dem Gelände befindet sich eine Forststation, deren Mitarbeiter bereits mehreren Generationen von Gelsenkirchener Stadtkindern durch Umweltbildung und Naturerfahrung die „neue Wildnis“ nähergebracht haben. Die Forststation ist eine etablierte und unersetzliche Institution im Ballungsraum.
Wissenschaftliche Forschung wird auf Rheinelbe und zwei anderen Industriebrachen in der Umgebung im Rahmen des Industriewaldprojektes betrieben. Im Jahr 2026 feiert das Industriewaldprojekt bereits sein 30-jähriges Jubiläum und gehört damit wahrscheinlich bundesweit mit zu den am längsten laufenden Forschungsprojekten. An dem interdisziplinären Projekt sind u. a. der Landesbetrieb Wald und Holz, die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet und die Ruhr-Universität Bochum beteiligt. Untersucht werden die Sukzession der Flora und Vegetation, die Waldentwicklung, eine Reihe faunistischer Gruppen, die Bodenentwicklung und die Bodenbiologie auf den Industriewaldstandorten. Die zentrale Frage ist dabei, wie die ungesteuerte Waldentwicklung und die Biozönose auf ehemaligen Industrieflächen auf verschiedenen technogenen Substraten mit unterschiedlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften im Ballungsraum verlaufen. Das Wald-Klimaxstadium wird dabei auf den Sonderstandorten voraussichtlich kein Buchenwald sein, der in der Region die Potenzielle Natürliche Vegetation darstellt, sondern er entwickelt sich über ein durch Betula pendula und Betula ×aurata geprägtes Zwischenstadium in einen Mischbestand aus Baumarten wie Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior und Quercus robur.
Diese „neuen Wälder des Ruhrgebiets“ werden Schwerpunktthema dieses Exkursionsteils sein. Den Abschluss bildet ein Aufstieg auf die Spitze der Halde Rheinelbe mit der „Himmelstreppe“ als Landmarke. Hier haben wir bei klarem Wetter nicht nur eine freie Sicht über weite Teile des mittleren Ruhrgebiets, sondern finden auf den offenen Industrieböden aus bodensaurem Bergematerial artenreiche Pflanzengesellschaften aus dem Verband des Dauco-Melilotion u. a. mit Senecio inaequidens, Hypericum perforatum und Echium vulgare und mit etwas Glück auch seltenere Arten wie Epilobium brachycarpum, Centaurium erythraea oder erste Jungpflanzen von Dittrichia graveolens. Faunistische Besonderheiten sind Blauflügelige Ödland- und Sandschrecke, Schwalbenschwanz, Mauereidechse sowie seltene Amphibienarten wie Kreuz- und Geburtshelferkröte.

Halde Rheinelbe mit „Himmelstreppe“ und Ruderalvegetation auf Bergematerial, Blänken auf der Halde und Ausblick über das mittlere Ruhrgebiet, Industriewald (Fotos: C. Buch).

Betula ×aurata, Centaurium erythraea und Dittrichia graveolens (Herbstaspekt) (Fotos: C. Buch).
Wegstrecke:
1. Ziel Henrichshütte: ca. 5 km, wenig anspruchsvoll, kaum Steigung, wenige Treppen. Auf dem Gelände der Henrichshütte befinden sich Toiletten, eventuell besteht die Möglichkeit, den Hochofen zu besteigen.
Mittagspause mit Selbstverpflegung (ggf. Nutzung eines Imbisswagens) auf dem Gelände der Henrichshütte. Ca. 30 min. Fahrtzeit zum zweiten Exkursionsziel.
2. Ziel Rheinelbe: ca. 5 km, teils unbefestigte Waldwege und kleinere, aber teils steilere Steigungen und Treppen, am Ende ca. 100 Höhenmeter über einen asphaltierten Weg zum Gipfel der Halde.
Exkursionsleitung: Corinne Buch, Oliver Balke, Birgit Ehses, Cornelia S. Wagner
Exkursion 4: Sandlandschaft im Münsterländischen Tiefland – ehemaliger Truppenübungsplatz Borkenberge, Haltern
Themen: Sandlandschaft im Münsterländischen Tiefland, Vegetation und Flora der Calluna-Heiden und Sandtrockenrasen, invasive Arten, Pionierarten temporärer Kleinstgewässer
Der ehemalige Truppenübungsplatz Borkenberge befindet sich im Nordwesten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, im Städtedreieck Haltern, Dülmen und Lüdinghausen. Aufgrund der langjährigen Nutzung als Schießplatz seit 1873 und als militärischer Übungsplatz ab etwa 1935 ist dort ein großflächiger Ausschnitt der kulturhistorischen, offenen Heide- und Moorlandschaft des Sandmünsterlandes erhalten geblieben. Die Borkenberge zeichnen sich durch eine hügelige Sandlandschaft aus mit Erhebungen bis zu 134 Metern über NN (Fischberg) aus. Der geologische Untergrund besteht aus maritimen Ablagerungen aus der Oberkreide (Halterner Sande). Das Landschaftsbild wird von einem Mosaik aus Heiden, verschiedenen Sandtrockenrasen-Typen und Vorwäldern geprägt. Aufgrund der langjährigen Nutzung als Truppenübungsplatz durchziehen zahlreiche Fahrwege das Gelände wie ein Spinnennetz. Diese Struktur erweist sich insbesondere für die Ausbildung von Pionierfluren als von signifikanter Relevanz. Das Gebiet weist die für viele militärische Übungsplätze charakteristische Zonierung auf. Es gibt einen zentral gelegenen, ehemals militärisch intensiv genutzten rund 300 ha großen Kernbereich, der von einer überwiegend waldbestandenen Pufferzone umgeben ist.
Info: Es werden zwei Exkursionen in das Gebiet Borkenberge angeboten. Die Exkursion 4 am Samstag beschäftigt sich mit den Sandlandschaften; die Exkursion 5 zu den Mooren findet am Sonntag statt.
1. Ziel: Heidelandschaft – Entwicklungen nach Abzug des Britischen Militärs
Am Samstag schauen wie uns die sandgeprägte Vegetation an. Dazu gehören die feuchten Sandginster-Heiden (Genisto–Callunetum molinietosum). Sie nehmen mit rund 100 Hektar den größten Flächenanteil ein, sind überwiegend kennartenarm ausgebildet und stark mit Molinia caerulea vergrast. Im Vergleich dazu stellen die Sandwege einen Hotspot der Biodiversität dar und sind ein Refugium für zahlreiche Pionierarten. Neben verschiedenen Sandtrockenrasen-Gesellschaften des Thero-Airion, kommen hier auch Zwergbinsenfluren mit gefährdeten Arten wie Illecebrum verticillatum und Corrigiola litoralis vor. Ein zunehmendes Problem für den Naturschutz sind die Verbuschung und Vergrasung sowie die Ausbreitung invasiver Arten (u. a. Cytisus striatus, Ulex europaeus, Rosa rugosa) im Offenlandbereich.

Heidelandschaft in den Borkenbergen (Foto: K. Wittjen).

Dianthus deltoides, Scleranthus polycarpos, Jasione montana, Illecebrum verticillatum (Fotos: K. Wittjen).
Wegstrecke:
Westrand Sandtrockenrasen (ca. 400 unbefestigter Sandweg, z. T. tiefer Sandboden), Ostrand Sandtrockenrasen, temporäre Kleinstgewässer, Aussichtspunkt Steinberg (85 m NN, ca. 650 m unbefestigter Sandweg, überwiegend sehr tiefer Sandboden).
Exkursionsleitung: Kerstin Wittjen
Exkursion 5: Heidemoore – ehemaliger Truppenübungsplatz Borkenberge, Haltern
Themen: Vegetation und Flora der Heidemoore
Info: Es werden zwei Exkursionen in das Gebiet Borkenberge angeboten. Die Exkursion 4 am Samstag beschäftigt sich mit den Sandlandschaften; die Exkursion 5 zu den Mooren findet am Sonntag statt.
1. Ziel: Moore – Noch regenerierbares Heidemoor & unberührtes Kesselmoor
Die Moore in den Borkenbergen sind aufgrund der Vielzahl seltener Arten, die sie beherbergen, von hohem ökologischen Wert. Sie befinden sich im Waldgürtel der Borkenberge und sind für den offiziellen Besucherverkehr nicht zugänglich.
Das Süskenbrocksmoor liegt am Nordrand der Borkenberge und ist ein sogenanntes Heidemoor mit Hochmoorvegetation. Dieses Moor weist ein besonderes Wasserregime auf. Neben Regenwasser wird es auch durch Oberflächenwasser der Borkenberge und Grundwasser gespeist. Der Kontakt zum Mineralbodenwasser wird durch die großen Narthecium ossifragum-Bestände deutlich. Zu den vegetationskundlichen Besonderheiten gehören die Orchideenarten Dactylorhiza sphagnicola und D. maculata subsp. elodes. Das Süskenbrocksmoor hat die Vergangenheit nicht unbeschadet überstanden. Das Gebiet ist in Teilbereichen von zahlreichen Gräben durchzogen (Grüppenstruktur) und entwässert in Richtung Norden. Gemäß der Preußischen Uraufnahme erfolgte in einigen Bereichen Torfabbau im bäuerlichen Handtorfstich. Die Entwässerung macht sich durch ausgedehnte Molinia caerulea-Bestände und eine zunehmende Verbuschung bemerkbar. Aktuell ist damit begonnen worden, die Grüppen zu verschließen. Um eine Beeinträchtigung der trittempfindlichen Vegetation zu vermeiden, ist eine Begehung des Gebietes vom Südrand aus vorgesehen. Zum Abschluss der Exkursion besuchen wir das Heimingshofmoor am Südrand der Borkenberge. Es handelt sich hierbei um ein aktiv wachsendes, nahezu unberührtes, ca. 1 Hektar großes Kesselmoor, das sich in einer abflusslosen Dünensenke befindet. Der beeindruckende, 6.000 m² große Schwingrasen wird überwiegend von Sphagnum fallax aufgebaut. Darauf hat sich ein Mosaik aus Sphagnum fallax-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft, Erico-Sphagnetum und Sphagno-Rhynchosporetum entwickelt. Südlich des Schwingrasenkomplexes erstreckt sich ein großflächiges Caricetum rostratae, das in einen offenen Moorkolk mit Utricularia neglecta (= australis auct.) übergeht.

Süskenbrocksmoor – Heidemoor mit Hochmoorvegetation in den Borkenbergen (Foto: K. Wittjen).

Narthecium ossifragum, Vaccinium oxycoccos, Sphagnum rubellum, Sphagno-Rhynchosporetum (Fotos: K. Wittjen).
Wegstrecke:
Südrand Süskenbrocksmoor (ca. 200 m schwer begehbares Moorgelände mit Molinia-Bultstadien), Heimingshofmoor (ca. 1 km Sandweg vom Parkplatz aus, im Gebiet ohne Wegeführung durch das Gelände mit schwer begehbaren Molinia-Bultstadien und Sukzessionswald).
Exkursionsleitung: Kerstin Wittjen
Nachexkursion – Winterberg
Themen: Montane Beerenstrauchheide und Bergmähwiesen, Flora und Vegetation, Genese und Naturschutzmaßnahmen
1. Ziel: Die Hochheide Neuer Hagen bei Niedersfeld
Das NSG „Neuer Hagen“, auch als Niedersfelder Hochheide bekannt, ist mit rund 77 ha Nordwestdeutschlands größte Bergheide. Sie liegt an der Landgrenze von NRW und Hessen in einer Höhenlage von rund 800 m ü. NN. Neben rund 60 ha Bergheide umfasst das Gebiet auch ein Hangquellmoor und andere Vegetationseinheiten wie Borstgrasrasen. Geologisch handelt es sich um Hangschuttlehme auf Diabas als Grundgestein. Im Gebiet befinden sich mehrere Quellbäche, die über die Hoppecke letztlich der Weser zufließen. Das Klima ist subozeanisch mit Jahresmitteltemperaturen um 6 °C. Historisch wurde das Gebiet von den umliegenden Ortschaften durch Plaggenhieb zur Gewinnung von Stalleinstreu genutzt. In Wärmezeiten wurde hier auch Ackernutzung betrieben. Die Entstehung der weitgehend waldlosen Freifläche geht auf den Holzeinschlag für Verhüttung und Waldweide zurück. Ende der 1980er Jahre begannen umfangreiche Entwicklungsmaßnahmen. Auf großen Teilen hatte sich ein Vorwald entwickelt, da die Heide seit Jahrzehnten nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wurde. Unterschiedliche maschinelle Plaggverfahren wurden zur Wiederentwicklung verjüngter Bergheidebestände eingesetzt. Um den Rückgang von Arnika-Beständen aufzuhalten, wurden in den letzten Jahren auch Stützungspflanzungen aus der Nachzucht mit gebietseigenem Material durchgeführt. Die Heide wird zur Pflege von einem Wanderschäfer mit Schafen und Ziegen beweidet.

Montane Beerenstrauchheide Neuer Hagen, Winterberg-Niedersfeld, bestehend aus den vorherrschenden Zwergsträuchern Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea und Calluna vulgaris (Foto: Biologische Station Hochsauerlandkreis).
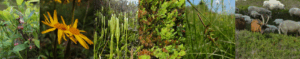
Vaccinium uliginosum, Arnica montana, Lycopodium clavatum, Empetrum nigrum (an ihrer kontinentalen Verbreitungsgrenze) zwischen Vaccinium myrtillus, Carex pulicaris, Pflege durch Hutebeweidung mit Schafen und Ziegen (Fotos: Biologische Station Hochsauerlandkreis).
2. Ziel: Bergmähwiesen und Borstgrasrasen im Skigebiet Altastenberg (Winterberg)
In einem Talkessel beim Winterberger Höhendorf Altastenberg in etwa 700 bis 780 m ü. NN Höhe finden sich Bergmähwiesen, die zu den besonders artenreichen Ausprägungen der Goldhaferwiesen (Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis) im Rothaargebirge zählen. An sanft geneigten Plateaus bis hin zu steilen Hängen, in wechselnder Exposition und im Einfluss unterschiedlicher Nutzungen durch Landwirtschaft und Wintersport entstanden verschiedenartige Varianten. In flachgründigen Partien weisen sie Übergänge zu Borstgrasrasen (Polygalo-Nardetum strictae) mit individuenreichen Vorkommen von Thesium pyrenaicum auf. In einem LIFE Plus Projekt (2011-2016) bemühte sich die Biologische Station im Hochsauerlandkreis auch hier im Skigebiet um eine Optimierung bzw. Wiederherstellung montaner Grünlandtypen. Zu den Maßnahmen gehörten das Einbringen von Kennarten in Bestände, die an Arten verarmt waren sowie die Restitution von Bergwiesen, Borstgrasrasen und Bergheiden aus Fichtenforsten. Die Exkursion führt auch zu montanen Hochstaudenfluren mit Cicerbita alpina und Ranunculus platanifolius.

Bergmähwiesen im Skigebiet bei Neuastenberg (Foto: Biologische Station Hochsauerlandkreis).

Phyteuma nigrum, Crepis mollis, Geranium sylvaticum, Rhinanthus angustifolius, Thesium pyrenaicum, Cicerbita alpina (Fotos: Biologische Station Hochsauerlandkreis).
Wegstrecke:
1. Ziel: Der Neue Hagen liegt auf einem Hochplateau. Der etwa 4,5 km lange Rundweg führt über meist unbefestigte Pfade mit nur geringen Steigungen und ist leicht zu gehen. Wegen einiger feuchter Partien empfehlen wir wasserdichtes Schuhwerk.
2. Ziel: Der knapp 3 km lange Weg enthält mäßig steile Weg- und Pfadabschnitte und am Ende einen 100 m langen Steilanstieg über eine Skipiste. Weniger agilen Teilnehmern ist ein einfacherer zu gehender Rückweg über Wege möglich.
Exkursionsleitung: Werner Schubert, Holger Krafft, Dr. Axel M. Schulte
